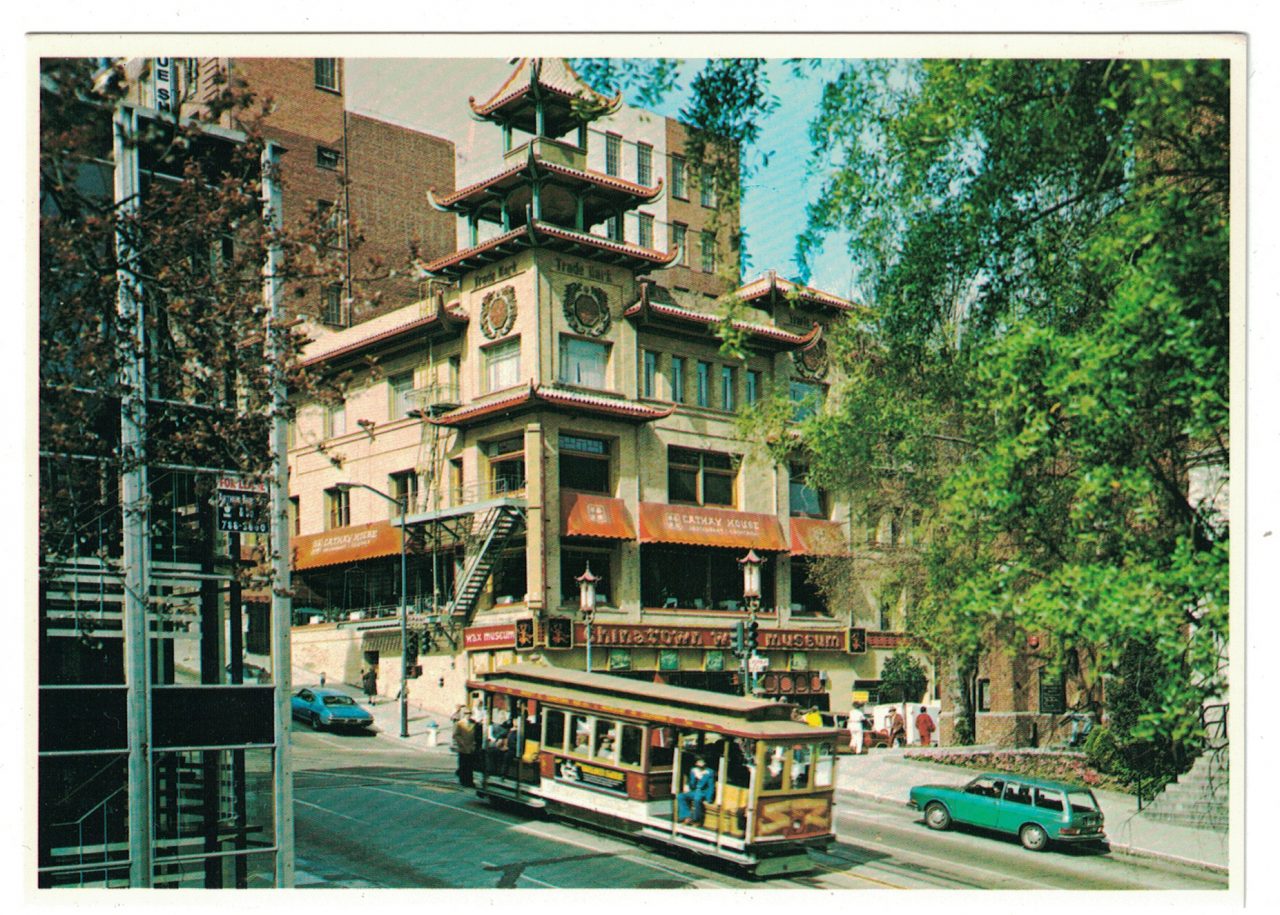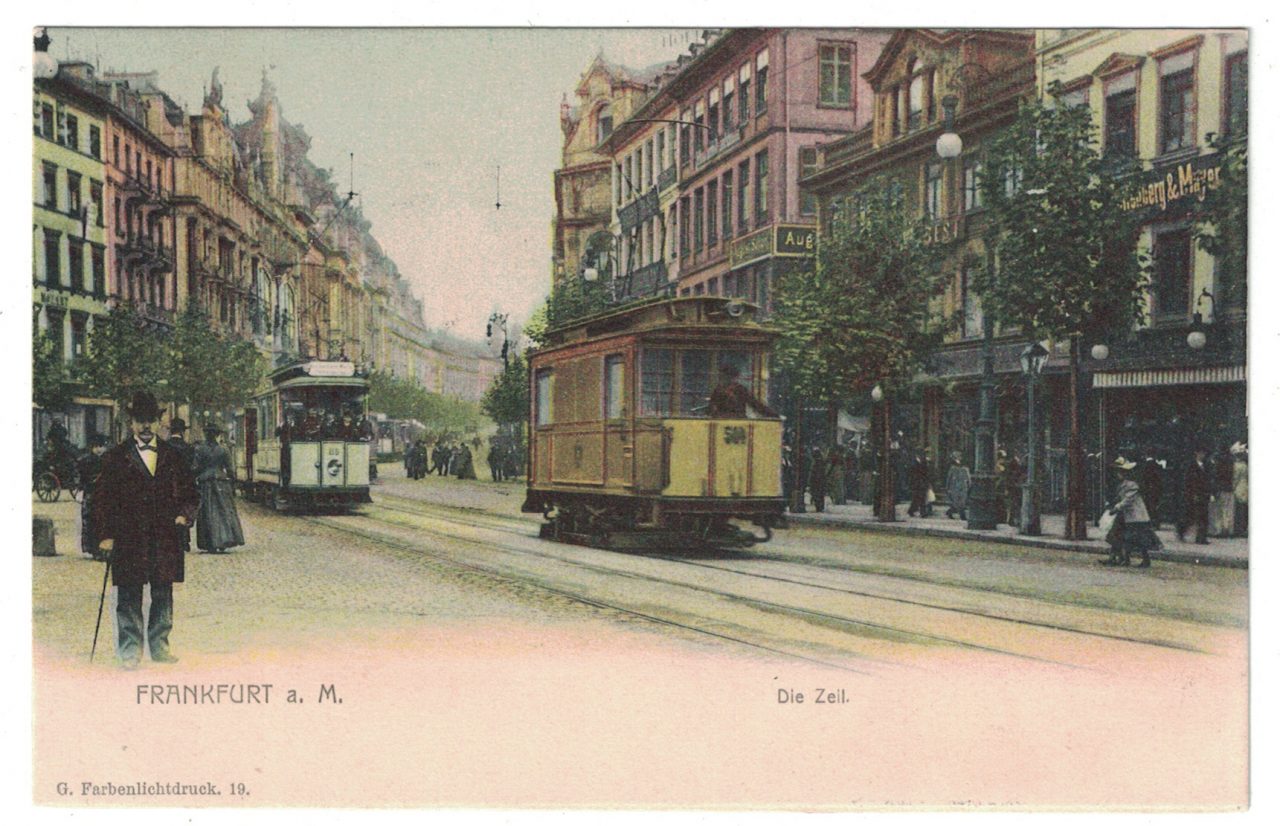Wir haben den Osten Deutschlands bei den “Bildern der Woche” bisher vernachlässigt. Das gleichen wir diesmal etwas aus und präsentieren eine Aufnahme aus Magdeburg. Sie zeigt Tw 413 im Breiten Weg an der Haltestelle „Alter Markt“. Im Hintergrund erkennen wir das Rathaus mit dem Alten Markt davor. Die beiden Kirchtürme gehören der Johanniskirche.
Wir befinden uns im Zentrum der Stadt, denn der „Breite Weg“ ist die traditionelle Hauptverkehrsader in Nord-Süd-Richtung. In früheren Jahrhunderten errichtete die „bessere Gesellschaft“ hier ihre prächtigen Palais und Bürgerhäuser, was den Breiten Weg als eine der schönsten Barock-Straßen Deutschlands bekannt machte. Der Zweite Weltkrieg ließ die ganze Pracht allerdings in Schutt und Asche sinken.
Die DDR baute ihre Bezirks(haupt)städte teilweise in einem Stil wieder auf, der älteren Vorbildern nachempfunden war und „Sozialistischer Klassizismus“ genannt wurde. Rechts sehen wir eine Fassade aus dieser Zeit. Als man später mehr Mut hatte und glaubte, auch über das nötige Geld zu verfügen, entstand im Rücken des Fotografen eine Zeile von vier modernen Hochhäusern, die als beliebtes Postkartenmotiv die Gestaltungskraft des Sozialismus demonstrieren sollten. Die damalige Karl-Marx-Straße wurde schon zu DDR-Zeiten verkehrsberuhigt und der Autoverkehr in die parallele Otto-von-Guericke-Straße verbannt. Die „Nachwendezeit“ ist allerdings mit diesem Vermächtnis teilweise äußerst rüde umgegangen und hat neue „Konsumtempel“ in die Straßenzeilen gedrückt.
Auf Schienen befahren wird der Breite Weg in ganzer Länge seit der Eröffnung der ersten Pferdebahnlinie am 14. Dezember 1877. Er bildet seitdem das „Rückgrat“ des Straßenbahnnetzes, von dem dann später verschiedene Zweiglinien in Ost-West-Richtung abzweigten. Da sich daraus eine gewisse Störanfälligkeit bei Verkehrsstörungen ergab, bauen die Magdeburger Verkehrsbetriebe seit einigen Jahren an der „Zweiten Nord-Süd-Verbindung“, die außerdem die Stadtteile westlich der ebenfalls in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Eisenbahnstrecken direkter miteinander verbinden soll. Erst vor wenigen Wochen wurde die Spange zwischen der Sudenburger Linie und der Strecke in der Leipziger Straße eröffnet.
Tw 413 kommt gerade von der Kreuzung des Breiten Wegs mit der Ernst-Reuter-Allee, dem zentralen Streckenkreuz des Magdeburger Netzes. Dort finden wir sogar eine „Grand-Union“, eine doppelgleisige Straßenbahnkreuzung mit allen acht denkbaren Abzweigmöglichkeiten. Einschränkend muss man allerdings anmerken, dass eine der Abzweigungen aus einer vorgezogenen Weiche mit einem kurzen dritten Parallelgleis hervorgeht.
Zu dem im Hintergrund sichtbaren Rathaus verkehrte die Pferdebahn ab 1884. Die Konzession war an eine zweite, konkurrierende Gesellschaft vergeben worden, weil der „Platzhirsch“ unannehmbare Bedingungen gestellt hatte. Die Strecke bestand bis 1955, als man die Verbindung auf das rechte Elbufer in die benachbarte Ernst-Reuter-Allee (damals Wilhelm-Pieck-Allee) verlegte. Übrig blieb eine Wendeschleife, die erst in den 90er Jahren beseitigt wurde.
Bei dem hier sichtbaren „Alten Rathaus“ handelt es sich um eine Rekonstruktion der Nachkriegszeit, deren Bau sich bis 1979 hinzog. In dem kleinen Türmchen mit dem grünen Dach vor dem Rathaus befindet sich der „Magdeburger Reiter“, ein Standbild aus der Zeit um 1240; damals das erste seiner Art.
Tw 413 gehört zu den historischen Fahrzeugen des „Museumsdepot Sudenburg“ der Magdeburger Verkehrsbetriebe. Mit Baujahr 1966 ist er ein recht junges Exemplar der Baureihe T2-62. Trotzdem war auch er von der regen „Verschieberei“ der Gotha-und Tatra-Wagen zwischen den DDR-Verkehrsbetrieben betroffen, denn schon nach 11 Jahren musste er 1977 den neuen Tatra T4D weichen, wurde nach Dessau versetzt und dort ab 1978 als Tw 42 eingesetzt. Anfang der 90er Jahre kehrte er mit einem passenden ex-Magdeburger Beiwagen von dort zurück und beide wurden Teil des Museumsbestands.
Je sieben Trieb- und Beiwagen sowie ein Schienenschleifwagen geben im ehemaligen Betriebshof Sudenburg einen Überblick über die Entwicklung der Straßenbahnfahrzeuge in Magdeburg. Dabei reicht das Spektrum von einem Pferdebahnwagen des Jahres 1888 über einen Triebwagen von 1899 bis zum ersten Tatra T4D-Zug.
-gk- / Foto: -gk-
Quellen:
• Wikipedia
• Günther, Klaus: Magdeburger Straßenbahnen; Aachen 1999